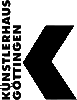
Künstlerhaus Göttingen
Bilder und Objekte
Weißer Saal
27. März – 27. April 2025
„Sammle dich – und Welt wird Schein
Sammle dich und Schein wird Wesen”
Hermann Hesse
Es verwundert erst einmal, dass ein Künstler, der als Bildhauer ausgebildet wurde, sich zu einem Maler von einer derart subtilen Farbkultur entwickelt hat, wie es bei Erhard Joseph der Fall ist. Das Grundprinzip der Plastik ist der Wechselbezug von konkav und konvex, von räumlicher Vertiefung nach Innen oder einer Wölbung nach Außen. Dieser Wechselbezug ist nicht nur mit den Augen zu erfassen, sondern auch körperlich mit den Händen zu „begreifen”. Die Malerei dagegen bewegt sich im Prinzip auf der zweidimensionalen Fläche, auf der sie durch die Wechselwirkung der Farben zueinander, beispielsweise in der Farbperspektive, die Illusion, den „Schein” von Räumlichkeit zu erzeugen vermag.
Allein ein Ausstieg aus einem üblichen Muster, bietet auch die Möglichkeit, etwas Neues entwickeln zu können. Georg Christoph Lichtenberg, der vor rund 250 Jahren bei uns im Künstlerhaus gelebt und gelehrt hat, bemerkte diesbezüglich in seinen Sudelbüchern: „Man muss etwas Neues machen um etwas Neues zu sehen“.
In einer früheren Malaktion im Rahmen unserer experimentellen Reihe der Kunst-Sequenzen wurde der plastische Aspekt der Malerei von Erhard Joseph deutlich: Er nannte die Aktion in Anspielung auf das berühmte Bild von Caspar David Friedrich: „Kreuz im Gebirge”. In diesem Bild wurde der Gipfel des Gebirges durch das Abendlicht dramatisch in Szene gesetzt. Die organische Felslandschaft wurde dabei von der geometrischen Form eines Kreuzes beherrscht. Erhard Joseph legte in seiner Analogie einen großen Papierbogen auf den rasterartigen Fliesenboden hier im Weißen Saal im Künstlerhaus, zeichnete dann das technische Muster von 3×3 Quadraten darauf und drückte sodann den Bogen so zusammen, dass daraus ein Papierknäuel entstand mit einer Faltenbildung in der Art eines Gebirges, mit Tälern und Höhenwölbungen. Als er über dies Gebilde Farbe schüttete, entstanden in den Faltungen Rinnsale wie in organischen Gebirgsstrukturen. Aber von oben, aus der Vogelperspektive, zeichnete sich durch das technische Raster der Quadrate wiederum auch ein Kreuz ab.
In dieser einfachen Demonstration hat er bereits damals das Verfahren veranschaulicht, das er bei seinen Bildobjekten entwickelt hat. Die Malfläche bleibt nicht zweidimensional flach, wie in der Malerei üblich, sie wird durch Knicke, die durch Faltungen entstanden sind, zu einer ins räumliche gezogenen, dreidimensionalen Bildebene. Dabei wählt er ganz einfache geometrische Muster wie Rechtecke oder Dreiecke als Grundlage für seine Komposition der Flächen zueinander. Diese einfachen Elemente ermöglichen eine vielfache Veränderung der farbigen Kombinationsmöglichkeiten. Und damit beginnt der spannende Malprozess, in dem Erhard Joseph eine komplexe Palette der Farbgebung eröffnet.
Indem er Flächen zu Farbgruppen oder Farbstreifen zusammenfasst, bei denen er Ihnen eine verbindende Tönung gibt, setzt er sie gegen andere ab. Im fortlaufenden Malprozess stellt er diesen wieder andere Farbflächen entgegen. Immer begreift er es als einen Wechselprozess der Farbflächen zueinander, nicht nur im Nebeneinander, sondern auch im Übereinander. Zumeist setzt er dabei Kontrastfarben ein, auch diese wieder häufig im Nebeneinander, aber auch im Übereinander. Dieses dynamische Wechselspiel wird hauptsächlich in intensiven Farbnuancen durchgeführt. Manche Farbstreifen zeigen möglicherweise auch die Ordnung von Farbfamilien, wobei die Farben wie beim Regenbogen fließend ineinander übergehen. In anderen Partien stoßen sie möglicherweise auf komplementäre Kontraste, Gelb steht Violett gegenüber, Blau Orange oder Rot einem Grün, vielleicht sogar einem blassen Grün, denn auch in der Farbhelligkeit kann es zu Gegenpositionen kommen. Erhard Joseph pflegt in diesen Beziehungen keine Systematiken. Er folgt in seiner Farbwahl seiner Intuition. In der Regel entstehen seine Bilder in einem langwierigen Prozess, bei dem jede Farbveränderung an anderer Stelle wieder Reaktionen auslösen kann.
Eine weitere Form der Farbgebung bildet zudem noch die Art des Farbauftrags, dabei wählt Erhard Joseph häufig eine lasierende Auftragsweise, bei der die untere Farbe in der oberen Schicht durchschimmert, auch das kann durch verschiedene Verfahren des Farbauftrags erzeugt werden. Erhard Joseph hat dabei eine Art und Weise entwickelt, die er besonders gerne einsetzt, weil sie durch einen Malmaterialwechsel zu einer speziellen Raumwirkung der Farben führt. Er liebt es, in frisch aufgetragene Ölfarbe, das pulverige Material des Pigments einzustreuen, beziehungsweise mit einem Sieb wie Puderzucker aufzustauben. Dabei ergibt das reine Material des Farbpigments eine differenzierte Oberflächenwirkung und es lässt sich je nach der Art des Streuens der Farbe eine andere Raumwirkung erzeugen. Senkrecht aufgesiebte Farbe führt eher zu einer deckenden Wirkung, dagegen wirkt schräg aufgesiebte Farbe eher transparent, weil sie, wie Streiflicht in einer Landschaft bei tief stehender Sonne, eine stärkere räumliche Wirkung entstehen lässt. In dieser Weise sind die Knicke und die krustigen Farbablagerungen auf der dreidimensionalen Bildfläche, die durch vielfältige Farbüberlagerungen entstanden sind, ein signifikantes Merkmal der räumlichen Auseinandersetzung, die Erhard Joseph in seiner Malerei führt.
Die stärkste Wirkung vermag Kunst zu erzielen, wenn sie in ihrer Konzeption und ihrer Durchführung Stringenz und Konsequenz erkennen lässt. Die Schönheit dieser Malerei ist mehr als schöner Schein, sie ist das Wesen dieser Kunst.
Georg Hoppenstedt